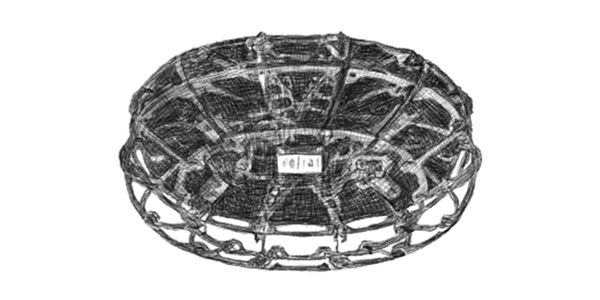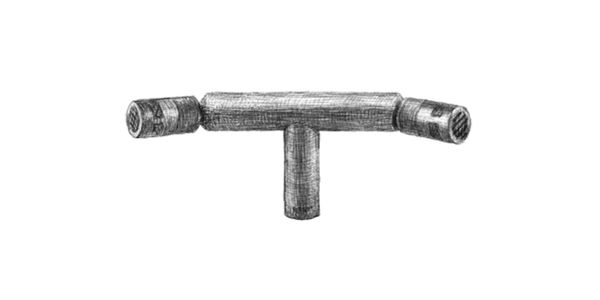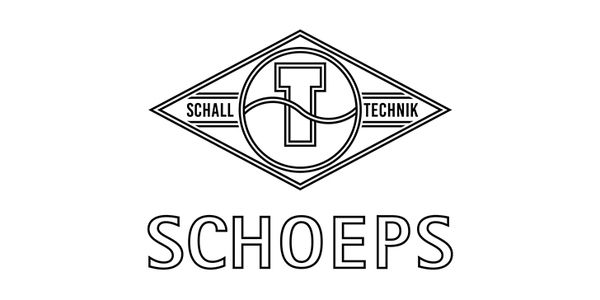2024
KMIT
Produktlaunch
CMD 42
Produktlaunch
1990

KFM 6
Das Kugelflächenmikrofon KFM 6, das auf der theoretischen Arbeit von Günther Theile basiert, ist so konzipiert, dass es dem natürlichen Hören eines Menschen möglichst nahe kommt. Es nutzte zwei Druckempfänger auf der Basis der MK 2XS.
1960
1952