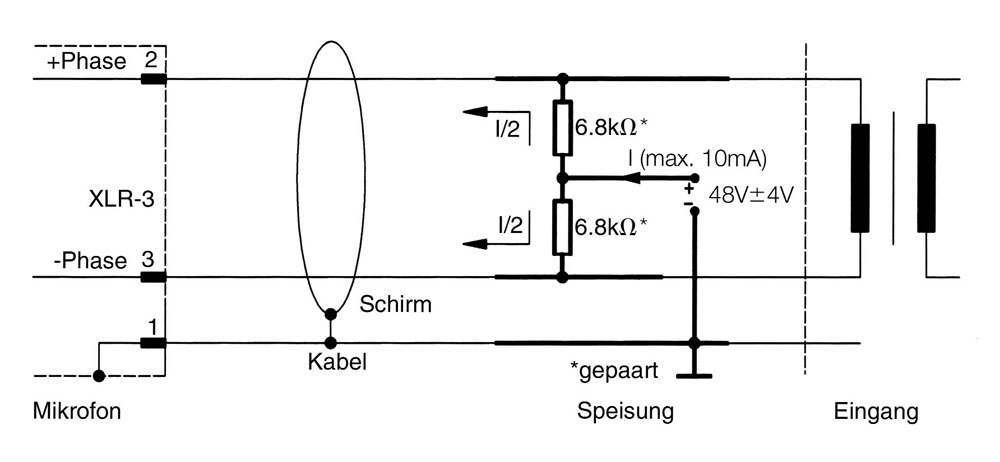Der CMT 20-Serie folgte 1964 die CMT 200-Serie mit verbesserter Empfindlichkeit und der erstmaligen Verwendung der "Schoeps-Ausgangsschaltung", die seitdem von zahlreichen anderen Herstellern nachgeahmt wurde. Viele Mikrofone dieser beiden Serien wurden bis 1966 verkauft, als Neumann die ersten Kondensatormikrofone vorstellte, die mit dem heutigen Standard von 48 Volt arbeiten. Diese Spannung (anstelle der 60 Volt, für die die Kapseln ausgelegt waren und die den Mikrofonen einen größeren Dynamikbereich verliehen hätten) wurde vor allem deshalb gewählt, um einem frühen Kunden entgegenzukommen, der diese Spannung zufällig in seinem elektrischen Hilfssystem zur Verfügung hatte.
Was die 48-Volt-Phantomspeisung als De-facto-Standard etablierte, war ihr Einsatz in den deutschen Rundfunkanstalten. Dadurch wurde neben der parallelen Speisung und 12-Volt-Phantomspeisung auch die 48-Volt-Phantomspeisung zur DIN-Norm. Damals waren die Rundfunkanstalten noch staatlich kontrolliert und zentral verwaltet, was die Beschaffung von Geräten anging. Ihre Netzgeräte waren auf die Telefunken-Röhre AC 701 genormt, und ein geringer Strom aus der 120-Volt-Plattenversorgung konnte über einen einfachen Spannungsteiler mit einer niedrigeren Spannung, z. B. 48 Volt, einem transistorisierten Mikrofon zugeführt werden. Solche Vorkehrungen erleichterten den Übergang von Röhrenmikrofonen, da sie eine jahrelange, überlappende Nutzung ermöglichten.
Man kann jedoch sagen, dass die 48-Volt-Stromversorgung in vielen anderen Anwendungsfällen noch jahrelang Probleme und Kosten verursachte. Die meisten Solid-State-Audiogeräte verwendeten intern keine derart hohen Gleichspannungen, so dass die frühen Benutzer dieser Mikrofone oft spezielle, externe Netzteile kaufen mussten, bis Konsolen, Recorder und Vorverstärker auf den Markt kamen, die diese unsägliche Spannung bereits eingebaut hatten.
Als zuverlässige Miniatur-DC/DC-Wandler verfügbar wurden, begannen die Mikrofonhersteller, verbesserte Modelle anzubieten, die ihre Kapseln für einen optimalen Dynamikbereich mit der vollen Designspannung polarisierten (obwohl dies dann den erforderlichen Betriebsstrom erhöhte, den nicht alle Konsolen und Recorder liefern konnten). Und übertragerlose Ausgangsstufen (ebenfalls von Schoeps entwickelt) mit ihrer geringeren Ausgangsimpedanz und Klangverfärbung, ihrer besseren Fähigkeit, lange Kabel zu treiben, und ihrer höheren maximalen Schalldruckleistung fanden zunehmend Verwendung.